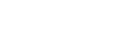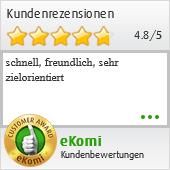Die Infrastruktur:
Nach wie vor nicht ausreichend
An und für sich wäre die geringere Reichweite der E-Autos kein Problem, doch wird dieses durch die noch mangelhafte Infrastruktur herausgearbeitet. Ein wenig ist die Ladestruktur damit vergleichbar, dass ein Autofahrer jahrelang nur die Autobahnen des dicht besiedelten NRW kennt – und nun im Urlaub durch Mecklenburg-Vorpommern oder Bayern fährt. Die bloße Tankstellendichte ist dort wesentlich geringer, sodass nicht wenige Autofahrer im Stau mit bangem Blick auf die Tanknadel hoffen, dass die nächste Tankstelle in 60+-Kilometern noch irgendwie erreicht werden kann. In Bezug auf die E-Autos, gibt es jedoch markante regionale Unterschiede:
- Städte – gerade die oft als »hip« oder »trendig« bezeichneten Städte sind relativ gut ausgestattet, was sich allerdings nur auf die aktuellen E-Autos bezieht. In anderen Städten kann es hingegen schon geschehen, dass die Ladesäulen äußert rar gesät oder kaum vorhanden sind.
- Land – auch hier gibt es massive Unterschiede. Manchmal werden Säulen auf öffentlichen Parkplätzen installiert, manchmal verbinden Städte ganz offensiv das Parken mit Lademöglichkeiten. In anderen Fällen verschreiben sich Discounter oder Supermärkte auf ihren eigenen Parkplätzen den E-Autos und bieten gezielt Ladesäulen an.
Allgemein sind die Städte und Regionen noch längst nicht mit ausreichenden Lademöglichkeiten ausgestattet. Hier geht es auch speziell um die Schnellladesäulen, die das E-Auto innerhalb weniger Minuten wieder mit Strom versorgen. Gleichzeitig gibt es weitere Probleme:
- Anschlüsse – das Laden erinnert ein wenig an die verschiedenen Ladekabel von elektrischen Geräten. Denn auch nicht jedes Kabel kann mit jedem Auto oder jeder Ladesäule genutzt werden. Es gibt jedoch Adapter, nur müssen die vom Fahrer angeschafft oder vom Ladesäulenbesitzer zur Verfügung gestellt werden. Eine allgemeine, universell passende Ladelösung wäre natürlich sinnvoll.
- Kosten/Tarife – wer daheim lädt, der kann einen festen Tarif mit seinem Stromversorger abschließen. Unterwegs müssen jedoch die Ladesäulen und Anbieter der Installateure genutzt werden. Ob Fahrer nun beständig Säulen einer »Kette« aufsuchen, weil sie dort ein Kundenkonto haben oder ob die Abrechnung je nach Örtlichkeit unterschiedlich erfolgt, sollte künftig auch klar geklärt sein. Das gilt insbesondere in Verbindung mit den Anschlussmöglichkeiten.
Ferner sollte beachtet werden, dass das Stromnetz auch die entsprechenden Kapazitäten bereitstellen muss. So wird zwar mittlerweile sehr viel Strom aus erneuerbaren Energien erzeugt, jedoch ist das Hochspannungsnetz für den Transport der Mengen noch nicht ausgelegt. Hochspannungsnetze transportieren die Energie über weite Strecken und können somit Windstrom aus dem Norden in andere Teile Deutschlands weiterreichen. Hier hakt der Ausbau jedoch noch, da es immer wieder Bürgerproteste gegen Stromtrassen gibt und die Genehmigungsverfahren zum Teil lange dauern.